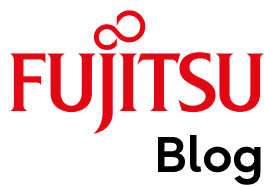Vergangenen Sommer sind wir mit unserer Rolemodel-Serie gestartet. Seitdem haben wir schon einige Frauen zu ihrem ganz persönlichen Weg zu und bei Fujitsu befragt – und sie um einen Tipp gebeten, den sie allen Menschen für ihren Karriereweg mitgeben möchten.
Wir freuen uns sehr, heute den ersten Mann in dieser Reihe aufzunehmen. Gerd Jooß ist Beauftragter für politische Verbindungen und Vorsitzender des Fujitsu Pride-Networks in der Region CEE (Central & Eastern Europe). Wir haben mit ihm über seinen Werdegang bei Fujitsu, den Außenhandel mit der ehemaligen DDR und das Fujitsu Pride-Netzwerk gesprochen – und wie das alles zusammenhängt.
Der Anfang bei Siemens in Westberlin
Doris: Hallo Gerd. Danke, dass Du Dir heute Zeit für unser Gespräch nimmst. Da Du CEE-Vorsitzender des Fujitsu Pride-Networks bist und ich Diversity-Managerin bei Fujitsu, haben wir ja öfter miteinander zu tun. Ich finde es auch jedes Mal schön, von Dir zu hören!
Gerd: Hallo Doris! Ja, freut mich auch.
Doris: Wir haben schon bei früheren Gelegenheiten über Deine bewegte Vergangenheit gesprochen. Manchmal klang das wie in einem Kalter-Krieg-Spionagethriller und ziemlich abenteuerlich… Magst Du unseren Leser*innen da auch ein bisschen was verraten und etwas über Deinen Werdegang erzählen?
Gerd: Na klar. Lass uns im Jahr 1983 beginnen. Damals versuchte ich, legal in Westberlin zu bleiben, um der Wehrpflicht zu entgehen. Hätte ich an einem anderen Ort der BRD gewohnt, hätte ich zur Bundeswehr gemusst. Zu der Zeit suchten die Karstadt-Häuser in Berlin jemanden, der ihre Computercenter aufbaut und leitet. Da ich in dem Unternehmen, in dem ich gelernt hatte, in der IT-Abteilung war, habe ich mich dort beworben – und wurde genommen.
Bei Karstadt war ich dann im Verkauf und wurde kontinuierlich zu Computern, IT-Fragen usw. geschult. Ich hatte recht hohe Umsätze, weil ich wohl von den Kund*innen als glaubwürdiger Ansprechpartner wahrgenommen wurde. Das ging so bis 1986. Zu dem Zeitpunkt war ich aufgrund einer bestandenen Aufnahmeprüfung für Führungskräfte sogar für den IT-Einkauf in der Zentrale in Essen vorgesehen. Dazu kam es allerdings nicht mehr, da ich im November 1986 im Direktvertrieb „PC-Bereich“ bei der Siemens AG eingestiegen bin – der Anfang meiner IT-Karriere und damit die Basis für meine heutige Position.
Doris: Du bist also durch den gesamten Wandel hinweg, von Siemens über Fujitsu Siemens bis hin zur Fujitsu Technology Solutions im Unternehmen geblieben – und damit schon über dreißig Jahre dabei? Wow!
Gerd: Ja, richtig. 34 Jahre, um genau zu sein.
Außenhandel mit der DDR: wie aus einem Spionage-Thriller
Doris: Und wie ging es dann weiter?
Gerd: Bei der Siemens AG wurde es im Vergleich zu meinem vorherigen Job technischer und „größer“. So ein MS-DOS-Rechner mit zwei Disketten-Laufwerken kostete damals um die 15.000 DM, das Gerät hatte 640 kB Arbeitsspeicher. Meine Kund*innen waren vorwiegend Handwerker oder auch Anwaltskanzleien – denen musste man erst einmal erklären, wozu eine solch große Investition sinnvoll ist. Ein Rechner war damals eine große Anschaffung, vergleichbar mit dem Autokauf heute.
1987 habe ich mich für den Außenhandel mit der DDR gemeldet, weil ich fand, dass da eine große Industrienation vor unserer Haustür lag, die keiner auf dem Schirm hatte. Dieses Gebiet habe ich bis zum Tag der deutschen Wiedervereinigung betreut. So lange war die DDR mein Vertriebsgebiet für MS-DOS basierte Rechner.
Doris: Aus dieser Zeit hast Du mir ja bereits einige Geschichten erzählt. Die klangen teilweise wie direkt aus einem Spionage-Thriller…
Gerd: Naja, das war teils schon abenteuerlich. Es gab die sogenannte Ko-Komm-Liste. Das heißt, es bedurfte einer Genehmigung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und dem US Department of Commerce für einen Export in die DDR. Es gab eine technische Obergrenze und wenn man die Obergrenze überschritt, wurden die Anträge abgelehnt. Die DDR hatte aber ein großes Interesse an Technologie oberhalb dieser Leistungsgrenze, um den Anschluss an den Westen nicht zu verpassen. Sie versuchten immer, das Maximum auszuschöpfen und ggf. auch Bestimmungen auszuhöhlen, um noch mehr zu bekommen.
Damals lag die Grenze bei 8-Mega-Hertz-Rechnern. Die DDR wollte jedoch 12-Mega-Hertz, mehr Arbeitsspeicher und bessere Grafikkarten. Daran waren auch die Staatssicherheit und der Polizeiapparat interessiert und suchten ganz gezielt nach Erpressungsmöglichkeiten. Sie arbeiteten gerne nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche und setzen das vor allem ab 1988 immer stärker ein, weil die Anforderungen der Betriebe in der DDR stiegen und die 8-Mega-Hertz-Rechner einfach zu wenig Leistung hatten. Bei mir fanden sie schnell eine Angriffsfläche: meine damals noch versteckte Vorliebe für attraktive Männer. Das führte zu sehr unschönen Situationen.
Als 1989 die DDR immer instabiler wurde, nahmen die Erpressungsversuche und Repressalien zu. Das ging dann so weit, dass man mich zum Verhör einbestellte oder am Grenzübergang festhielt und mir ein paar eindeutige Bilder vorlegte. Die DDR-Beamten fragten mich, was mein Beruf damit zu tun hätte und was denn die Siemens AG davon halten würde. Sie könnten sich aber auch vorstellen, dass ein junger Mann wie ich auch Wünsche hätte, wie z. B. ein schönes Auto. Es wurde also in beide Richtungen probiert, Zuckerbrot und Peitsche eben…
Auch wenn dieses Vorgehen der DDR-Behörden keinen Erfolg hatte, weiteten sie es auf eine geschickte Art und Weise so aus, dass ich mir am Ende nicht einmal mehr sicher sein konnte, ob nicht vielleicht auch „Fallen“ in meinem Tagesgeschäft in Westberlin lauerten.
Nach der Wende: Infineon und Quimonda
Doris: Wie ging es nach dem Ende der DDR weiter?
Gerd: Erst einmal waren die sogenannten „neuen Bundesländer“ weiterhin mein Bereich – aber eben bei meinem „neuen“ Arbeitgeber, der Siemens-Nixdorf AG. Die ehemaligen Kund*innen, die sich nun teilweise selbstständig machten, brachten mir noch immer ein großes Vertrauen entgegen. Dass sie mich kannten, brachte da wirklich einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern.
In Dresden entstand damals eine neue Chip-Infrastruktur vom Siemens-Bereich „Halbleiter“ – die Siemens Mikroelektronik, die wir heute unter dem Namen Infineon kennen. Ich begleitete zu dieser Zeit – vom ersten Baucontainer bis zur Ausgliederung von Quimonda – die Kunden Infineon und Quimonda. Diese Verbindung reichte bis ins Jahr 2011 – eine unheimlich lange und vertrauensvolle Kundenbeziehung. Und das war auch tatsächlich der erste Kunde, bei dem ich zum Beispiel auf die Frage, was ich denn so am Wochenende gemacht habe, offen antwortete: „Ich war mit meinem Freund unterwegs“. Und es wurde absolut respektvoll aufgenommen. Es wurden sogar unbekannterweise „Grüße“ ausgerichtet. Da dachte ich mir: Donnerwetter Gerd, das war einfach. Wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich damit schon eher offener umgegangen.
Keine Angriffsfläche mehr bieten
So kam es dann auch, dass ich 1994 eine Regenbogenfahne auf mein neues Auto geklebt habe. Damit fuhr ich am nächsten Tag auf den Parkplatz der Siemens AG und machte damit für mich und andere sichtbar, dass es diese Angriffsfläche für Erpressungsversuche ab jetzt nicht mehr gab. Es gab da nämlich in meiner Abteilung durchaus immer wieder Versuche, mich bei der Geschäftsleitung oder dem Abteilungsleiter in ein schlechtes Licht zu rücken. Außerdem kamen auch komische Sprüche und doofe „Witze“ – sie waren da, die ständigen Gemeinheiten. Das gipfelte in dem Versuch mir etwas „anzuhängen“: Eine Kollegin behauptete, ich hätte sie sexuell belästigt. Daraufhin musste ich beim Hauptabteilungsleiter erscheinen, der aber sehr souverän reagierte, weil er ja wusste, dass ich schwul bin.
1994 war ich dann auch das letzte Mal mit so einer Situation konfrontiert. Mit dem beruflichen Erfolg kam auch eine gewisse Selbstsicherheit. Ich hatte auf Incentive-Reisen vorher immer eine gute Freundin mitgenommen. Dass es meine Partnerin war, hatte mir eh niemand abgenommen – aber ich dachte irgendwie immer, sie würden es tun. Man macht sich da gerne selbst etwas vor und ich war wirklich gut darin. Bis ich irgendwann feststellte, dass es total unnötig war. Das wurde mir aber erst klar, als ein Kollege mal sagte: „Nimm doch das nächste Mal, einfach Deinen Freund mit. Wir kennen jetzt Deine zauberhaften Freundinnen, aber wir würden wirklich gerne mal Deinen Freund kennenlernen – wenn Du einen hast. Meine damaligen Chefs haben diese klare Aussage auch noch untermauert. „Wir freuen uns. Das ist gut so. Und wenn es jemandem nicht passt, dann lass es uns wissen.“
Doris: Hast Du das auch getan?
Gerd: Ja, habe ich. Beim nächsten Mal war mein Freund dabei – und der Effekt war phänomenal. Für die meisten hatte es noch immer einen Anschein von etwas Exotischem. Aber es gab auch viele Reaktionen à la „ich kenn ja auch so einen“. Am Gala-Abend saßen überall Männlein mit Weiblein am Tisch und wir als gleichgeschlechtliche Partner waren einfach etwas Besonderes. Das war einfach nicht selbstverständlich.
Rückendeckung durch die Führungskraft
Doris: Ich finde es cool, dass Du das tatsächlich gemacht hast, eben weil es nicht so selbstverständlich war. Und von Deinem Chef war es auch toll, dass er Dir Rückendeckung gegeben hat. Zudem sich diese nicht nur auf „wir haben kein Problem damit“ beschränkte, sondern auch die Versicherung, dass Du zu ihm kommen kannst, wenn jemand eines hat. So stellt man sich eine gute Führungskraft vor, oder?
Gerd: Ja, definitiv. Ende der 90er waren da alle recht klar und die Message war eindeutig: „Es wird Dich keiner diskriminieren“ und „Du hast nichts zu befürchten“. Es wäre aber sonst auch irgendwie albern gewesen. Ich nahm zu der Zeit aktiv am Berliner Christopher Street Day teil und habe dort immer größere Fahrzeuge organisiert, zum Schluss war es ein 3-achsiger LKW. Und diese Teilnahme war auch dezidiert politisch. Bei der Parade konnten mich dann ja auch Kolleg*innen sehen, wie ich mit einem Transparent Gleichstellung forderte. Da wäre es komisch gewesen, wenn diese zur Parade und zum Feiern gekommen wären – aber mit meiner Einstellung ein Problem gehabt hätten. Zum Christopher Street Day geht man nicht nur wegen der Party. Da geht es auch um ein Anliegen.
Damals gab es auch die eingetragene Partnerschaft noch nicht – von der ich nebenbei nie ein großer Fan war, weil das nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ich fand immer, dass es da eine komplette Gleichstellung geben muss.
Ich wurde mit dem Ganzen dann offensiver, vor allem aber als Privatperson. Zwar gab es keine direkte Diskriminierung mehr, aber das offene Eintreten für solche Themen seitens des Unternehmens gab es damals eben auch noch nicht. Dass Unternehmen dazu nach außen treten und Stellung beziehen, ist doch eher eine Entwicklung der letzten Jahre. Für mich war das aber schon damals sehr wichtig und es war mir völlig unverständlich, dass mein Bekanntheitsgrad nicht genutzt wurde, um die Firma bei diesem Thema auch zu platzieren.
Pride und die Community
Doris: Was bedeutet für Dich Pride?
Gerd: Pride umfasst für mich alles an Vielfalt, was die Community ausmacht, insbesondere Toleranz. Allerdings muss ich zugeben: Auch die Community hat hier manchmal noch Entwicklungsbedarf. Insgesamt scheint es dort schon mehr Toleranz zu geben als in der heterosexuellen Welt, aber ganz oft muss ich auch feststellen, dass die gleichen Klischees gelten. Nur um das Thema Transgender zu nennen – da rollen leider immer noch viele die Augen, weil sie nicht verstehen, was das für diese Menschen bedeutet. Ich habe das auch lange nicht verstanden. Aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man es auch verstehen. Da gehört aber eine gewisse Offenheit dazu und ein Wille, sich damit auseinanderzusetzen.
Doris: Ich glaube, da sprichst Du etwas ganz Wichtiges an: Man muss sich damit beschäftigen. Erst unvoreingenommen zuhören und dann den Menschen empathisch begegnen. Das ist vielleicht ein Thema, welches nicht aus meinem direkten Erfahrungskreis stammt – aber diese Aussage gilt ja generell. Was war karrieremäßig der nächste Schritt?
Außenhandel mit China und erstes Netzwerken für das Unternehmen
Gerd: Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Fabrik in China IT-technisch mit aufzubauen und ich habe einfach mal „Ja“ gesagt. Ich hatte so etwas zwar noch nie gemacht, aber Außenhandel ist Außenhandel, oder? Und ehrlich gesagt: meine Erfahrungen mit einem repressiven Regierungsapparat sollten mir auch helfen. Mit meinen Erfahrungen aus Nanjing konnte ich auch andere Werke von Siemens mit IT-Technik unterstützen und habe das reichlich getan.
2009 musste ich dieses Engagement leider einstellen. Den Expat-Vertrag, mit dem ich für drei Jahre nach Shanghai gehen sollte, habe ich nicht mehr unterschrieben. Bis dahin war ich alle drei Monate für 10-14 Tage vor Ort. Aber die Wirtschaftskrise und die Erkrankung meiner Mutter haben mich zu dem Zeitpunkt an Deutschland gebunden. Nach 2009 habe ich mich wieder auf das Geschäft mit Infineon und Siemens konzentriert und nebenbei Infrastrukturprojekte betreut – Klimatechnik und Brandmeldeanlagen waren auch dabei, auch wenn es eigentlich nicht zu meinem Portfolio gehörte.
Ab den Nuller-Jahren habe ich auch für meinen Arbeitgeber das gemacht, was ich privat schon lange tat: Ich habe immer gerne Netzwerke gepflegt bzw. erweitert, bin auf politischen Veranstaltungen gewesen und bei den verschiedensten Verbänden. 2016 wollte zum Beispiel ein Manager von Fujitsu den CEO einer großen Versicherung kennenlernen und niemand konnte den Kontakt herstellen. Irgendwie kam das über Umwege bei mir an, und da ich diesen CEO kannte, habe ich einen Termin vereinbaren können. Da stand dann die Frage im Raum, woher die Verbindung kam – und ob es tatsächlich so etwas wie ein „rosa Netzwerk“ gibt. Ich war ehrlich und habe gesagt: ja, das gibt es und es ist ziemlich stark. Der Manager hatte danach Interesse an weiteren Geschäftskontakten und so kam es, dass ich 2017 mit der Aufgabe betraut wurde, politische Verbindungen und Kontakte in die Verbände herzustellen und zu pflegen. Und das mache ich heute noch.
Netzwerken heißt in erster Linie: etwas geben
Doris: Das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie die Potenziale, die Mitarbeiter*innen mitbringen, auch tatsächlich im Unternehmen genutzt werden!
Gerd: Ja, absolut! Ein von mir höchst geschätzter Kollege hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Aber es gab auch Widerstände und einige mehr als unschöne Versuche, mich in dieser Aufgabe zu verhindern. Teilweise wurde da erneut versucht, das Thema „gay“ anzusprechen und mich zu diskreditieren, was aber sofort dank einiger großartiger Menschen im Topmanagement abgeschmettert wurde.
Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Ein Netzwerk funktioniert nur, solang man es pflegt! Viele missverstehen das und denken, das funktioniert nach dem Prinzip „Ich gebe Dir und Du gibst mir“. So ist das aber nicht. Es läuft eher nach dem Prinzip: Du gibst etwas rein und von einer komplett anderen Stelle kommt etwas zu Dir zurück. Oder wenn Du darum bittest. Eines meiner Hauptmerkmale ist es, empathisch auf andere zuzugehen. So kam beispielsweise auch die Zusammenarbeit mit den Global Digital Women (GDW) zustande und die Unterstützung des Digital Female Leader Award im letzten und in diesem Jahr.
Manchmal kommt jemand mit der Frage „Was bringt mir das?“. Da kann ich nur den Kopf schütteln, denn da hat jemand das Konzept nicht verstanden. So einfach ist das nicht zu beantworten. Heute und auf den ersten Blick vielleicht bringt es nichts – morgen und auf den zweiten Blick sieht das aber vielleicht schon wieder anders aus. Netzwerken heißt in erster Linie: etwas geben. Empathisch aufeinander zugehen heißt immer gewinnen. Davon bin ich überzeugt.
Doris: Da sprichst Du etwas an, was mir sehr am Herzen liegt. Viele meinen, beim Netzwerken geht es darum, was sie davon haben. Dass es auch darum geht, Menschen zusammenzubringen, Gelegenheiten für andere zu sehen und sie dann darauf aufmerksam zu machen, Informationen zu teilen, einander voran zu bringen und so weiter – das sehen viele nicht.
Gerd: Klar, manchmal dauert es auch lange, aber es bringt so viel. Und oft ist der Erfolg des Netzwerkens auch nicht wirklich direkt messbar.
Schlussworte
Doris: Gibt es etwas, das Du zum Schluss anderen noch mitgeben willst?
Gerd: Geht offen mit Eurer Identität um – die anderen wissen es eh! Spielt kein Versteck, Ihr spart Energie und könnt Euch auf Wichtigeres fokussieren. Das setzt so unglaublich viel Potential und Kreativität frei. Sticheleien machen für die Anderen nur Sinn, so lange ihr Euch versteckt – danach wird es so etwas von uninteressant.